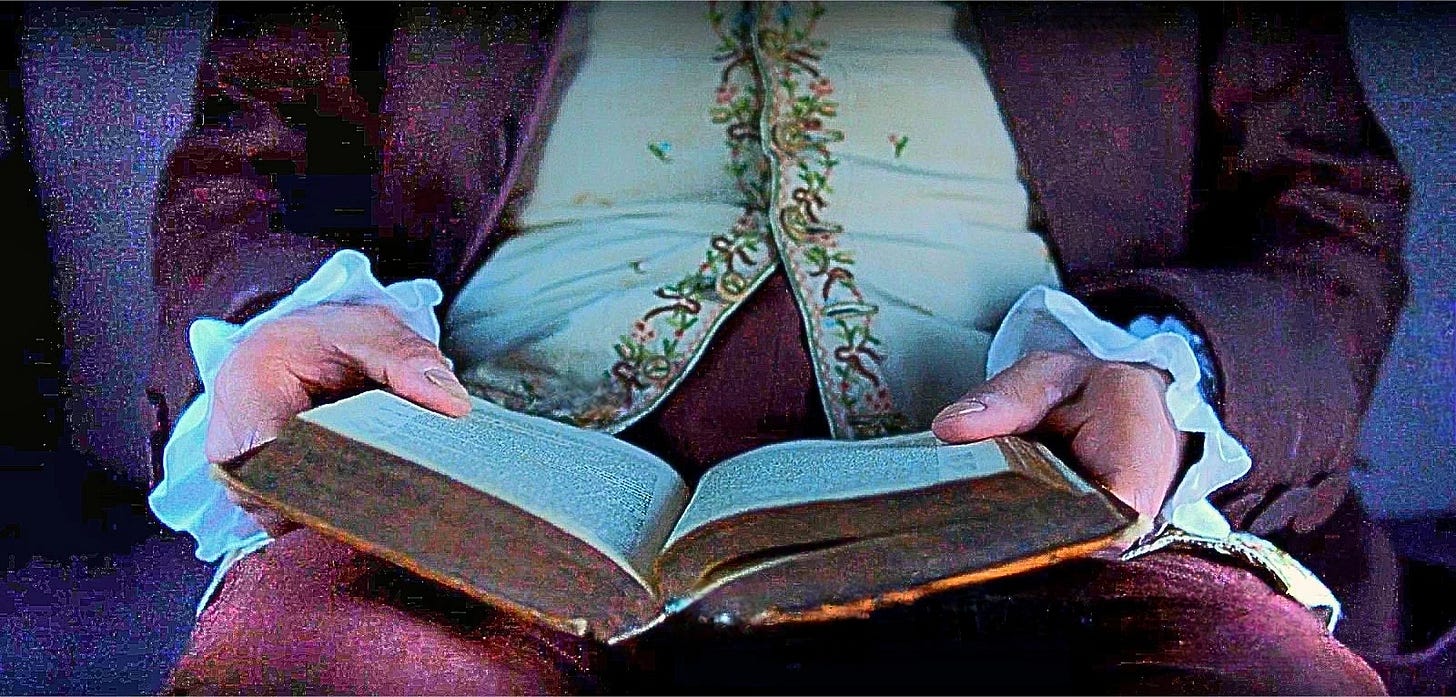Der Unterschied in der Musik
Gouverneur Morris und die Ethik des Fühlens
I. "Nicht gemacht, um hier zu bestehen"
In Paris war Gouverneur Morris in mehr als nur einer Hinsicht ein wahrer Exot. Als Amerikaner befand er sich in einer eigentümlichen politischen Position: verwurzelt in der Revolution, Mitverfasser und Redakteur der Verfassung, aber zugleich durch seine vorrevolutionäre Vergangenheit und seine inoffizielle Arbeit für George Washington und Thomas Jefferson auch mit Großbritannien verbunden. Im Gegensatz zu Letzterem jedoch, ein Sklavenhalter, der sich in den höfischen Kreisen wohlzufühlen schien, fand sich Morris dort nicht zurecht.
“Dieser Besuch, so kurz er auch ist, und der erste, den ich je einem Hof abgestattet habe, hat mich davon überzeugt, dass ich nicht dafür geschaffen bin, dort zu bestehen.” 1
Notierte er in seinem Tagebuch, nachdem Jefferson ihn mit nach Versailles genommen hatte.
Seine aristokratische Haltung (Madame de Lafayette zum Beispiel erzählte öffentlich herum, dass sie ihn für einen Aristokraten halte2* ), seine Verfassungstreue und seine ausgezeichneten Französischkenntnisse hätten ihn eigentlich prädestiniert, am Hof zu brillieren. Doch obwohl man ihn für einen versierten Höfling hielt, blieb Morris instinktiv und intellektuell auf Distanz zur glatten Gesellschaft von Versailles.

Während andere die unteren Schichten der Gesellschaft aus Palastfenstern oder prachtvollen Salons betrachteten, beobachtete Gouverneur das Leben von den Straßen aus: zu Fuß oder zu Pferd, allein, ohne Eskorte, ohne Furcht. Dort, mitten im Lärm und Hunger des revolutionären Paris, sah er Dinge, die die meisten seiner Klasse lieber übersehen hätten.
II. Ein Gewissen auf Straßenhöhe
An seinen Halbbruder General Staats Long Morris, selbst ein Symbol der alten amerikanischen Ordnung, da aber in England residierend, schrieb er keinen distanzierten Bericht eines Diplomaten, sondern eine zutiefst ehrliche Selbstbetrachtung.

Ein seltenes Geflecht aus scharfem Blick, gesellschaftlicher Kritik, persönlichem Geständnis und echtem moralischen Zwiespalt. Und komplett befreit davon je ins Sentimentale oder Moralistische abzugleiten:
“In der Tat haben sich keine der Bettler, die ich gesehen habe, über Kälte beklagt. Sie alle bitten um das Nötige für ein Stück Brot und zeigen durch ihren Gesichtsausdruck, dass sie mit “Brot” eigentlich Wein meinen. Und wenn die Wirte dieses letzte Wort auslegen würden, würden die armen Teufel feststellen, dass damit ein ganz anderes Getränk gemeint ist. Unter den Gestalten, die sich einem zeigen, gibt es zweifellos manche, die wirklich Almosen verdienen, aber diese gehen in der Menge von Vortäuschern unter. Dennoch bekommen sie von mir mein ganzes Kleingeld, und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich eher des persönlichen Friedens Willen gebe als aus Barmherzigkeit.
Die Spitzbuben haben wohl durch ihr Studium der menschlichen Natur herausgefunden, dass jeder Mensch sich selbst mehr liebt als seinen Nächsten, und deshalb ein Eigeninteresse daran hat zu geben. Die Reichen ihrerseits, als Förderer der Industrie, sind diesen Zudringlichkeiten gegenüber äußerst gleichgültig und versuchen, durch das Vorenthalten von Almosen die anderen zu zwingen, lieber zu arbeiten als zu betteln.
Die Wirkung der Gewohnheit auf beide Seiten ist bemerkenswert.Kürzlich beobachtete ich einen mir bekannten Gentleman, der bei einer Opernarie weinte, während er zuvor einen Bettler, der mit seinen Krücken hinter ihm herklapperte, eine ganze Straßenlänge lang ignoriert hatte, ohne sich umzudrehen.
Es stimmt, die Musik ist unterschiedlich.” 3
Der Inhalt dieses Briefes ist in meinen Augen außergewöhnlich.
Ich möchte ihn deswegen im Folgenden Schritt für Schritt analysieren.
III. Vom Geben und vom Gewissen
📌 Er erkennt das Versagen des Systems.
“Unter den Gestalten, die sich einem zeigen, gibt es zweifellos manche, die wirklich Almosen verdienen, aber diese gehen in der Menge von Vortäuschern unter.”
Gouverneur Morris erkannte, dass wahre Not unter einer Flut der Verzweiflung begraben lag. Doch anstatt den Bettlern die Schuld zu geben, sieht er: Das System zwingt sie zur Inszenierung. Nur wer sich darstellt, wird gesehen. Stille Würde verhungert ungesehen.
📌 Er gesteht sich seine eigene moralische Schwäche ein.
“Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich eher des persönlichen Friedens Willen gebe als aus Barmherzigkeit.”
Diese Zeile ist brutal ehrlich, seine Wortwahl fern jeglicher performativen Reue. Morris gesteht, dass er gibt, um sein eigenes Unbehagen zu beruhigen und nicht weil er ein guter Mensch sei. “Zu meiner Schande”, gibt er offenkundig zu. Das ist Selbstwahrnehmung auf höchster moralischer Ebene. Mehr, als viele heute öffentlich oder privat zu leisten vermögen.
Doch was Morris entweder nicht sieht (was ich bezweifle) oder sehr wohl sieht und hier dennoch bewusst tut, ist eine Form der Selbstkasteiung als stille Bitte um Absolution. Seine Motivation spielt nämlich überhaupt keine Rolle.
Seine Handlung bleibt barmherzig.
Ich bin deswegen überzeugt, dass er in seinem Original-Brief das Wort “Benevolence” (Barmherzigkeit) ganz bewusst wählte. Es verrichtet leise Arbeit im Satz. Dass er seinem Bruder gegenüber seine Absicht in Frage stellt, ist vielleicht ein Versuch, eine großzügige Geste zu rechtfertigen, die sonst als tadelnswert gelten könnte. Oder aber: Er will damit der möglichen Scham des Bruders zuvorkommen, um dessen Gewissen zu entlasten. Ein rhetorisches Mittel, das Gouverneur sehr häufig genutzt hat. Sinngemäß sagt er: “Wenn mein Verhalten dir das Gefühl gegeben hat, weniger barmherzig zu sein, dann liegt der Fehler bei mir.”
Doch eine Tatsache bleibt:
Wie auch immer man es liest, er gab. Freiwillig und selbstlos.
Er half.
Nicht nur dieser Brief, sondern auch viele Einträge aus seinen späteren Tagebüchern während seiner Reisen durch Europa zeigen ein Bild, das heute als Tugend wie auch als Schwäche gelten würde: Gouverneur Morris gab tendenziell zu viel. Er wusste, wenn er bestohlen wurde und gab trotzdem. Er verzichtete auf Verhandlungen, duldete Überzahlungen, um unangenehme Gespräche zu vermeiden. Er verschenkte große Summen an Menschen, die ihn hintergangen hatten, und forderte sie nie zurück. Sein persönlicher Frieden war stets mehr wert als das Geld. Und er betrachtete es stets im grösseren Zusammenhang um es sich selbst gegenüber zu rechtfertigen.
Deswegen ist es auch im hier zitierten Fall gut möglich, dass er mehr gab als er zugab. Die strukturelle Ungerechtigkeit machte ihn wütend, weil ihm nur das Geben von kleinen Almosen blieb. Es zusätzlich kleinzureden war seine Art, den Schmerz zu lindern, nicht mehr tun zu können. Denn er wusste ganz genau: Almosen sind keine Gerechtigkeit und die Motive dahinter ernähren niemanden. So gab er und fühlte sich dann schuldig, nicht tugendhafter zu sein. Dieser moralische Doppelkonflikt ist manchen nur allzu vertraut. Und genau darin liegt, ironischerweise, wahre Tugend, Grosszügigkeit und Gutmütigkeit.
IV. Als Aristokrat geboren – zum Revolutionär geworden
📌 Er versteht, wie die Armen die Reichen manipulieren... und umgekehrt.
“Die Spitzbuben haben wohl durch ihr Studium der menschlichen Natur herausgefunden, dass jeder Mensch sich selbst mehr liebt als seinen Nächsten, und deshalb ein Eigeninteresse daran hat zu geben.”
Das ist eine brillante Beobachtung. Morris verurteilt das nicht. Er anerkennt die Psychologie dahinter. Er sieht, wie das Betteln zur Strategie wird. Was bei anderen leicht in Zynismus kippen würde, formuliert Gouverneur als nüchterne Realität durchdrungen von Mitgefühl.
Diese Haltung zieht sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben. Die Spannung zwischen ererbtem Privileg und radikaler Empathie bildet den Kern seiner Persönlichkeit.
Gouverneur Morris wurde als Aristokrat geboren, profitierte von den landgräflichen Begünstigungen der britischen Krone und von der kolonialen Hierarchie. Aber anders als seine Standesgenossen klammerte er sich nicht an diesen Status. Stattdessen ließ er sich von seinem persönlichen Gewissen leiten geformt durch Vernunft und Ethik der Aufklärung und geschärft durch seine persönliche Erfahrung. Deswegen wandte er sich 1776 der Revolution zu, nicht dem Konservatismus oder der Monarchie. Seine Entscheidung für den Föderalismus statt für den Royalismus war offensichtlich nicht eigennützig, sondern selbstreflektiert. Selbstkritisch sogar: eine bewusste Ablehnung des Systems, das ihn hervorgebracht hatte und dessen Privilegien er sich sehr bewusst war.
Das machte ihn auch unter den Gründervätern einzigartig. Andere, die ebenfalls mit Reichtum, Ländereien und Sklaven geboren wurden – wie die Washingtons, die Jeffersons, die Livingstons, die Jays… – sie alle blieben emotional an jene Systeme gebunden, die sie vorgaben zu bekämpfen. Wieder andere wie Hamilton oder Lafayette, die ohne Besitz und Einfluss zur Welt kamen, arbeiteten und betrogen sich hoch, nur um diese Systeme nachträglich zu imitieren und zu verteidigen.
📌 Er sah von 1776 ins Jahr 2025.
“Die Wirkung der Gewohnheit auf beide Seiten ist bemerkenswert.”
Die Wirkung der Gewohnheit ist heute noch allgegenwärtiger als in seiner eigenen Zeit: Wenn ein Gutverdiener das teure Bio-Gemüse zurücklegt, weil es auch günstiger geht, während Menschen mit mehreren Jobs zur Tafel gehen müssen, dann ist das nicht Ignoranz. Es ist Gewöhnung. Eine tief eingeübte Blindheit gegenüber Armut, die längst keine Ausnahme mehr ist, sondern System.
Wie moderne Gesellschaften mit Armut umgehen ist die logische und langjährige Konsequenz von Morris’ beschriebener “bemerkenswerten Gewohnheit”. Die stärkste kapitalistische Ungerechtigkeit der Menschheitsgeschichte wird nicht mehr als Bosheit gesehen, sondern als lang eingeübter Reflex, der eigenes Unbehagen über das Elend anderer in rationalisierte Distanz verwandelt. Wenn selbst die Reichsten über Lebenshaltungskosten klagen, ist das Ergebnis nicht Heuchelei, sondern ein System, das gelernt hat, seine eigenen Lügen zu glauben.
Aber Gouverneur Morris? Er log nie über das Spiel. Er beschwerte sich über die unfairen Regeln und vergaß niemals jene, die gar nicht mitspielen durften. Er schritt durch Paläste und hörte trotzdem das Klappern der Krücken auf der Straße.
V. Empathie als politisches Modell
📌 Er kritisiert die Reichen.
“Die Reichen ihrerseits, als Förderer der Industrie, sind diesen Zudringlichkeiten gegenüber äußerst gleichgültig und versuchen, durch das Vorenthalten von Almosen die anderen zu zwingen, lieber zu arbeiten als zu betteln.”
Ein kalt-rationales System, das auch heute noch weltweit existiert: Hilfe wird verweigert, um Beschäftigung zu erzwingen.
Für Morris war diese Logik schon 1789 unmenschlich.
Er glaubte nicht daran, dass Menschen durch Grausamkeit zur Selbstständigkeit gebracht werden können wenn das System sie daran hindert.
Morris’ pragmatische Barmherzigkeit hat bis heute politische Echoeffekte. Die moralische Erschöpfung beim Geben, die manipulative Notwendigkeit des Bettelns, und die kalte Rationalität der Reichen, Hilfe vorzuenthalten. All das ist bis heute die tragende Logik vieler moderner Sozialstaaten.
Ein Beispiel: In Deutschland versucht das seit zwanzig Jahren bestehende Hartz-Konzept “Arbeit zu fördern”, indem es die Sozialleistungen absichtlich niedrig hält oft beschrieben als “zum Sterben zu viel, zum Leben nicht genug”. Diese absichtsvolle Verknappung beseitigt aber Armut nicht. Sie erzeugt sie. Gezielt. Bewusst. Weil eine herrschende Klasse, die im Kapitalismus gedeiht, keine Demokratie aus informierten Bürgern will.
Die Versuche mit Bedingungslosen Grundeinkommen lehnen die Idee ab, dass Würde durch Leid verdient werden muss. Sie gehen, wie Morris, davon aus, dass Menschen bessere Entscheidungen treffen, wenn sie nicht unter existenzieller Not leiden.
Morris’ oft missverstandene Skepsis gegenüber einer zu weit gefassten Demokratie während der Verfassungsdebatten beruhte nie auf Elitismus, sondern genau auf dieser Erkenntnis: Wird Reichtum und Armut im selben Abgeordnetenhaus vermischt, entsteht Oligarchie. Die Reichen übernehmen die Regierung.
Kommt uns das bekannt vor?
Seine Angst war damals schon berechtigt obwohl sie in seinem eigenen Land erst jetzt bewiesen wird. Er hat aber später noch selbst miterlebt, wie unterdrückte Armut in Frankreich in blutige Revolte explodierte. Eine Demokratie, in der die Ärmsten vergessen werden, wird am Ende von den Wütendsten übernommen. Morris’ Lösung dafür war Prävention statt Repression, indem man jedem Menschen Rechte an Körper und Existenz gibt. Etwas zu verlieren und damit etwas, worum es sich abzustimmen lohnt.
Das machte Gouverneur Morris tatsächlich zu einem echten Republikaner. Nicht im missbrauchten modernen Sinne, sondern im ursprünglichen, klassischen: als jemand, der an eine Gesetzesordnung glaubt, gegründet auf bürgerlicher Tugend, geleitet durch Vernunft, entworfen zum Schutz des Gemeinwohls.
Er trat nie für eine Aristokratie ein auch wenn Historiker es ihm bis heute unterstellen. Tatsächlich widerspricht das eher allem, was er gesagt, geschrieben und vertreten hat. Morris versuchte, die junge Republik vor dem Zusammenbruch unter der Last ökonomischer Verzweiflung zu bewahren, die in erster Linie zur Amerikanischen Revolution geführt hatte. Die Verzweiflung, die von der Oberschicht als Waffe eingesetzt wurde.
Trotzdem wusste er: Damit Demokratie funktioniert, müssten “We the People” gebildet, genährt und frei sein. Nicht manipuliert, hungrig und verängstigt.
Das war Republikanismus einst in seiner reinsten Form.
VI. Das Klappern der Krücken
Dies, für mich, ist der bemerkenswerteste Teil.
“Kürzlich beobachtete ich einen mir bekannten Gentleman, der bei einer Opernarie weinte, während er zuvor einen Bettler, der mit seinen Krücken hinter ihm herklapperte, eine ganze Straßenlänge lang ignoriert hatte, ohne sich umzudrehen.”
Auf den ersten Blick benutzt Gouverneur Morris Ironie, um performative Rührseligkeit zu kritisieren. Er beschreibt einen Bekannten, der bei Kunst weint, aber echtes Leid ignoriert. Eine Kritik, ja, aber keine banale. Denn sie richtet sich nicht nur gegen diesen Mann, sondern gegen den gesamten Ästhetizismus der Elite.
Und er nutzt dabei sich selbst. Wörtlich wie sinnbildlich.
Ein Gentleman, der im Theater weint? Das ist Morris.
“Ging dann ins französische Schauspielhaus, wo der honnête Criminel so gut gespielt war, dass er alle Gedanken an meine eigene Lage in Tränen ertränkte. O Gott, ich danke dir demütig für diese Sensibilität, die mein Herz für erfundene Freude und erfundenes Leid öffnet.” 4
Und ein Mann mit Gehbehinderung, in Paris’ Strassen? Auch Morris.
“Es stimmt, die Musik ist unterschiedlich.”
Das ist der Bruch:
Was gibt einem Mann die Erlaubnis, zu fühlen?
Der Gentleman, der zu tiefer Emotion fähig ist, der fiktive Trauer zulässt, aber den realen Schmerz nicht erträgt, obwohl er das beständige Klappern der Krücken hört. Der weiß, wie es sich anfühlt, Schmerzen zu haben.
Also verurteilt er beide: den Mann, der bei der Oper weint und den Bettler ignoriert und sich selbst gleich doppelt.
Es sind seine eigenen Tränen, denen er nicht traut. Seine eigenen Almosen, die er nicht verteidigen kann. Sein eigenes Gewissen, das er immer wieder ins Kreuzverhör nimmt.
Dieser Bruch in Gouverneurs Selbstbild war nicht gespielt. Er wusste, dass er kein herzloser Mensch war, aber er hatte bewusst seiner Privilegien Angst, nur scheinbar gut zu sein. Er fürchtete, dass seine Tugend eine Maske war getragen für andere und wie andere sie tragen. Dass er die Maske nur anpasste, wo er sich selbst verlieren könnte. Und doch, ironischerweise:
Gerade dieses Selbstzweifeln, diese Weigerung, sich selbst von der Verantwortung zu entbinden, das ist es, was ihn überhaupt erst gut machte.
Ich glaube aufrichtig (und ich werde in diesem Blog immer wieder Belege dafür liefern) es ist genau so, wie seine Freundin Madame de Damas ihn beschrieben hat. Sie kannte ihn sehr gut, denn er hatte sie in mehr als einer Hinsicht aus Gefangenschaft, vor dem Schafott und aus einer gewalttätigen Ehe gerettet.

“Würde man mich auffordern, ihn durch eine einzige Eigenschaft zu beschreiben, so würde ich sagen: Er ist gut.” schrieb sie in ihrem scharfsinnigen wörtlichen Porträt über Gouverneur Morris. Sie sah in ihm “viel von dem, was man Güte nennt” und “die Ausübung seiner Tugend in jeder Handlung seines Lebens.” 5
Doch woher stammt dann Gouverneurs tiefe Unsicherheit?
Diese Dissonanz zwischen seiner Selbstwahrnehmung und dem Blick anderer auf ihn? Das ist das psychische Rückenmark von Gouverneur Morris. Nicht was er dachte, sondern warum er so dachte, obwohl andere ihn anders sahen.
Warum sprach er so oft von sich mit moralischem Argwohn? Warum hielt er sich selbst für unzureichend, sogar im Privaten, obwohl er ganz offensichtlich intelligent, hellsichtig, menschlich, ehrlich und gerecht in seinem Umgang mit fast jedem Menschen war, den er kannte?
Gouverneur Morris’ soziale Stellung war ein Rätsel, das er nie lösen konnte. Ein Aristokrat von Geburt, aber ein Revolutionär durch Intellekt und Instinkt. In Versailles willkommen, aber er gehörte nicht dazu. In Salons bewundert, aber er vertraute ihnen nicht. Er ging unter Bettlern, aber konnte ihr Leid nicht beheben. Er wollte helfen, aber wusste zu viel, um zu glauben, dass Almosen genug sind.
VII. Ein Mann, der nicht wegsehen konnte
Gouverneur lebte in einem Zustand ständigen existenziellen Schwindels. Sein ganzes Leben war eine Aufführung in einem Raum, den er sich nicht ausgesucht hat, vor einem Publikum, das fortlaufend die Masken wechselte. Also gewöhnte er sich daran, sich selbst zu kritisieren, bevor andere es konnten.
Schon mit 16, als er der Jüngste Absolvent, Jahrgangsbester und Abschiedsredner am King’s College (heute Columbia) war, tat er dies in seiner ersten öffentliche Rede 6. Aber darüber werde ich einen separaten Beitrag schreiben.
Fakt ist: Er war zu intelligent, um mit sich selbst im Reinen zu sein. Er konnte sich nie in die aristokratische Illusion hineinschwindeln. Er konnte Shakespeare, Ovid, Machiavelli und Voltaire auswendig zitieren, aber er hat auch die Leichen gesehen, die die Ungerechtigkeit des echten Lebens produzierte.
Er konnte seinen Platz in der Welt niemals romantisieren aber er konnte ihn auch nicht verlassen. Und so blieb er ständig gefangen zwischen den zwei Selbstbildern: dem Schauspieler, der wusste, dass das Stück eine Lüge war und dem Mann, der die Bühne nicht verlassen konnte.
Und diese Bühne war schon damals Patriarchat und Kapitalismus.
Eine Welt in der Mitgefühl als unmännlich und Schwäche gilt.
Gouverneur Morris sah sein ganzes Leben lang, wie mächtige Männer Rücksichtslosigkeit, Grausamkeit und Brutalität belohnten: angefangen beim doppelzüngigen Thomas Jefferson, über seinen Freund Alexander Hamilton, der sich wie ein Messer in seinem Rücken verhielt, bis hin zu seinen Mentoren Robert Morris und George Washington, die ihn ausnutzten, solang es ihnen selbst was brachte. Sogar die Lafayettes, sein Kriegskamerad und dessen Frau, deren Leben er rettete, nutzten ihn finanziell aus. Und schließlich seine eigene Familie, die ihn nur als laufende Erbschaft betrachtete und nach seinem zu frühen Tod jahrzehntelang versuchten, seine Frau und sein Kind zu ruinieren.
Er sah gutherzige Menschen mit besten Absichten geköpft werden, aufgrund ihrer Geburt.
Gouverneur Morris zu verstehen heißt, einen Mann zu verstehen, der zeitlebens hin- und hergerissen war zwischen dem, worin er hineingeboren wurde, und dem, woran er glaubte. Ein Mann, der jeden Raum beherrschen konnte, aber sich selbst stets nur in die Fussnoten schrieb. Ein Mann, der versuchte, niemals grausam zu sein, selbst dann, wenn das Leben ihn dazu aufforderte.
Seine wahre Revolution war emotionale Integrität: Die Vorstellung, dass man die Seele eines Mannes daran misst, wovor er nicht die Augen verschließt. Die Vorstellung, dass Trauer und Mitgefühl nicht unmännlich sind, sondern der Beweis für ein funktionierendes Gewissen.
Und so, zum Schluss, muss ich zugeben: Ich bin es, die Unrecht hat, wenn ich seine strategische emotionale Vorwegnahme als Unsicherheit deute.
Er war schlichtweg nicht nur seiner Zeit voraus,
sondern auch allen anderen.
Einschliesslich ihm selbst.
Quellen und Übersetzungsangaben:
Morris, Anne Cary. The Diary and Letters of Gouverneur Morris. Trow’s, 1889. (S. 33)
ibid. (S. 35-36)
* in ibid. (S. 155) besucht Morris am Sept. 16th, 1789 Adrienne de Lafayette, die Comtesse de Tessé, in Versailles, nach seiner Rückkehr aus London, und kommt auf ihre Bemerkung von vor ein paar Monaten zurück, mit einem charmanten Konter, der sitzt;
”Wir führen ein heiteres Gespräch von einigen Minuten über ihre politischen Angelegenheiten, in das ich kluge Grundsätze der Staatskunst mit jener pikanten Leichtlebigkeit mische, die diese Nation so sehr liebt. Ich habe Glück, und als ich aufbrechen will, begleitet sie mich zur Tür und besteht darauf, dass ich bei meinem nächsten Besuch in Versailles bei ihr speise. Wir sind äußerst höflich zueinander, und plötzlich, in ernstem Ton: ‘Mais attendez, madame, est-ce que je suis trop aristocrate?’ [Aber warten Sie, Madame – bin ich etwa zu aristokratisch?] Sie antwortet mit einem Lächeln voll sanfter Verlegenheit: ‘Ah, mon Dieu, non.’ [Ach Gottchen, nein.]”
ibid. (S. 38-39)
Miller, Melanie Randolph. The Diaries of Gouverneur Morris. University of Virginia Press, 2011. (S. 60)
Miller, Melanie Randolph. An Incautious Man. Regnery Gateway, 2008. (S. 206)
Sparks, Jared. The Life of Gouverneur Morris Vol. 1. Gray & Bowen, 1832. (S. 11)
Alle Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche (sofern nicht anders angegeben) wurden von der Autorin in Zusammenarbeit mit ChatGPT (OpenAI, GPT-4o, August 2025) angefertigt.